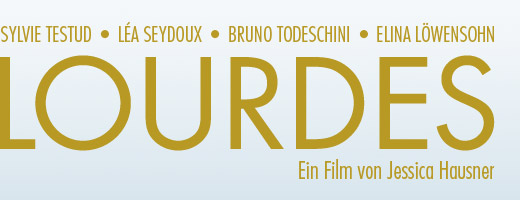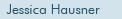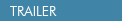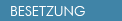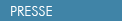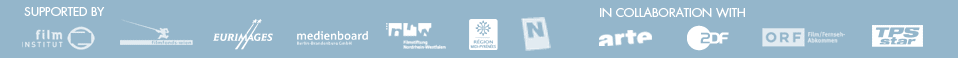WUNDER UND ANDERE SCHNITTSTELLEN
Jessica Hausner im Gespräch
Wie kommt eine österreichische Filmemacherin nach Lourdes?
Jessica Hausner: Ich wollte einen Film über ein Wunder machen und habe verschiedene Orte und
Geschichten, die von Wundern handeln, recherchiert. Lourdes hat am besten gepasst, da dort angeblich
Wunder passieren, es gehört irgendwie dazu: Man fährt insgeheim mit der Hoffnung dorthin,
dass man vielleicht geheilt wird. Ich fand es spannend, an einem Ort diesen Film zu erzählen,
wo das so quasi zum Alltäglichen dazugehört – ein Wunder.
Was war der nächste Schritt in Lourdes, das einerseits als katholische Legende und andererseits als
betriebsamer Ort voller Organisationen zu sehen ist?
Jessica Hausner: Der Ablauf einer Pilgerreise und auch die religiösen Rituale, das sind festgelegte Handlungsabläufe
die dort stattfinden. Für mich war es interessant, diese Rituale zu recherchieren. Im
weiteren Sinn ging es mir darum, wie sich eine Gruppe von Menschen verhält, wenn klare Regeln
vorgegeben sind. Wie etwa bei einem kirchlichen Ritual. Da ist völlig klar, dass das keine individuellen>
Handlungen sind, sondern ein Ritus. Und von dem erwartet man sich etwas. Indem man rituelle
Handlungen ausführt, wendet man sich – in dem Fall – an Gott, aber in jedem Fall an ein größeres
Ganzes.
Diese Rituale unterscheiden sich mitunter, wie man im Film sieht, nicht sehr wesentlich von einer normalen
Kunstreise von Kulturtouristen, die durch diverse Sehenswürdigkeiten durchgeschliffen werden.
Der Freiraum, den man vielleicht in seinen Wünschen erhofft, ist da letztlich sehr eingeschränkt.
Jessica Hausner: Es gibt da zwei gegensätzliche Aspekte in „Lourdes“. Das eine ist das vorgeformte Handeln
und eben diese gesellschaftliche Struktur, diese Hierarchie. In der Gruppe gibt es die Chefs,
die Pilger und die Kranken. Jeder erfüllt in gewisser Weise seine Aufgabe. Das andere ist das Wunder,
also irgendwie das Paradox, das Absurde: das, was niemand erwartet hat; auch wenn man es
vielleicht insgeheim erhofft. Das ist dieser Moment, wo niemand etwas dafür kann, wie das Glück.
Diese Kräfte stehen im Film gegeneinander. Das, was ich versuche, was ich mich zu bewirken bemühe,
und das, was von außen auf mich herunterfällt und was ich nehmen muss, wie es ist.
„Einen Film über ein Wunder machen“: Man könnte sagen, Ihr Film behandelt auch die Frage, ob
so ein Wunder nicht auch eine Zumutung ist und eine größere Belastung darstellt, als der vorherige,
unglückliche, „kranke“ Zustand. Könnten Sie den Aspekt des Wunders für eine filmische Erzählung
genauer beschreiben?
Jessica Hausner: Ein Wunder ist etwas Ambivalentes. Es ist schön für den, dem es passiert. Gleichzeitig
drückt es aber die Ungerechtigkeit aus, da es sehr zufällig ist, und dass, so wie es kommt, auch
wieder verschwinden kann. So beglückend es ist, wenn ein Gelähmter wieder gehen kann, so ist es
auch beängstigend. Es zeigt, dass es jederzeit passieren kann, und zwar irgendwem, dass es aber
genauso auch vergehen kann. Es zeigt also die Vergänglichkeit des glücklichen Moments.
Das Kino, per se, hat seit Georges Meliés, immer eine hohe Affinität zu Wundern gehabt, vor allem,
wenn man mit besonders guten Tricks zeigen kann, wie sich etwas Außerordentliches ereignet. Inwiefern
ist für Sie der Wunderbegriff mit den filmischen Arbeiten verknüpft?
Jessica Hausner: Ich habe mich bei „Lourdes“ bemüht, das Wunder so unwunderlich wie möglich zu erzählen. Von den filmischen Mitteln her, habe ich es realistisch erzählt, ähnlich wie bei „Hotel“ (Hausners
vorheriger Film, Anm.). Da habe ich einen Horrorfilm ohne Monster erzählt, also mit realistischen
Mitteln, die im Bereich dieser Realität bleiben, und dadurch wandert für mich eben das, was übernatürlich
ist, ins Off. Es passiert, ohne dass es gezeigt wird. Diese Dimension, die nicht fassbar ist, filmisch
zu erzählen, hat für mich immer damit zu tun, dass sie quasi zwischen den Schnittstellen liegt.
In Ihren Spielfilmen „Lovely Rita“, „Hotel“ und „Lourdes“ spielt der Kostümaspekt eine große Rolle. In
„Lourdes“ sind die Menschen kostümiert, durch ihre Uniformen definiert. Auch ihr Habitus wirkt stark
charakterisierend.
Jessica Hausner: Ich versuche, die Figuren, die in meinen Filmen vorkommen, mit ihrer gesellschaftlichen Rolle
zu erzählen. Es ist immer interessant zu sehen, „wer ich sein soll“, und „wer ich dadurch bin“. Ob
ich erfülle oder nicht erfülle, was man von mir erwartet, definiert auf eine Weise, wer ich bin. Ob
ich diese Rolle in der Gesellschaft spiele oder auch bin, drückt sich eben durch Handlungen aus. Es
gibt Vorschriften, und die Kostüme, die Uniformen, sind für mich wie der visuelle Ausdruck davon.
Ich bin nicht nur ich, sondern ich bin außerdem im Malteserorden die zweite Hospitiere von rechts,
und das ist mein Auftrag in der Gesellschaft.
Wie war für Sie der Umgang mit der französischen Sprache und dem französischen Ambiente?
Jessica Hausner: Grundsätzlich versuche ich eine Distanz zu dem, was ich erzähle, einzunehmen. Wenn ich
mir die Geschichte ausdenke, einen Drehort oder die Schauspieler suche, versuche ich zehn Schritte
zurückzugehen und mir das von außen anzuschauen. Seltsame Settings helfen mir dabei, das zu
erreichen. Orte wie Lourdes, oder die französische Sprache, das half mir die Geschichte, die ich da
erzähle, noch kühler zu betrachten.
War es schwierig, Drehgenehmigungen in Lourdes zu bekommen?
Jessica Hausner: Ich habe mehrere Recherchereisen nach Lourdes unternommen. Bei dieser Gelegenheit
habe ich mit der Stelle, die sich dort um Filmprojekte kümmert, Kontakt aufgenommen. Am Anfang
war das schwierig. Die Fragen, was das für ein Film werden soll und wie Lourdes dabei wegkommt
haben sich aber gut gelöst. Durch die langwierigen Recherchen ist so etwas wie gegenseitiges Vertrauen
entstanden. Die Zuständigen wussten, ich mache da einen Film, der, auch wenn er Lourdes
ambivalent gegenübersteht, trotzdem wertvoll sein kann. Sie haben sich also darauf eingelassen und
ich musste wiederum akzeptieren, dass wir teilweise, etwa in der Grotte, sehr beschränkte Drehgenehmigungen
hatten.
Verursachte die Frage, wie Glaube und Wundergläubigkeit abgebildet werden Skepsis bei den kirchlichen
Stellen?
Jessica Hausner: Es gab einige Gespräche mit dem Monsieur Jacques Perrier, dem Bischof von Tarbes und
Lourdes über die Frage, wie Lourdes dargestellt wird. Wir haben auch darüber gesprochen, was
ein Wunder ist, da es mich interessiert hat, wie die katholische Kirche Wunder erklärt. Es war faszinierend
zu hören, dass diese katholischen Würdenträger auch nicht sagen, „das ist weil Gott gut
ist und uns retten will“. Die Ambivalenz des Wunders an sich war ihnen natürlich bewusst. Letztlich
beschäftigt uns dieselbe Frage: „Was soll das ganze eigentlich und wo führt mich mein Leben hin?“.
Da gab es schon Überschneidungspunkte. Der Unterschied ist, dass ich mich vielleicht weigere die
Antworten zu geben und kirchliche Würdenträger eine Antwort für die Gläubigen parat haben
sollen.
Abseits dieses spezifischen, katholischen Settings in Lourdes, stellt Ihr Film die verschiedensten Konstellationen
von Liebe in Frage. Ist das eine grundlegende Skepsis von Ihnen gegenüber solchen Hoffnungsmomenten?
Jessica Hausner: Das Drama, um das es in „Lourdes“ geht, handelt davon, dass man eben hofft, alles möge
gut ausgehen. Man erwartet sich Liebe, hat Sehnsucht, hofft, dass irgendwer ein Netz aufspannt,
dass man geborgen ist. Im Gegensatz dazu erkennt man jeden Tag, dass dem nicht so ist, dass das
Weltall dunkel und kalt ist und man am Ende sterben wird. Dass das was man tut, vielleicht gut ist,
aber nicht dazu führt, ein erfülltes, glückliches Leben zu haben. Es geschehen andere Dinge, egal
ob man diese „Zufall“, „Glück“ oder „Gott“ nennt, die stärker sind und ihren Einfluss nehmen und die
Dinge nehmen einen unerwarteten (unerwünschten oder unverhofften) Verlauf.
Dieser Gegenpart ist mächtig und hat viel mit der Willkür der Ereignisse zu tun.
Diese Dunkeltönungen des Lebens, scheinen Ihnen als Filmemacherin sehr entgegenkommen. Ober ist
es existenzieller für Sie? Sylvie Testud hat ja eine gewisse Ähnlichkeit mit Ihnen. Gab es da eine Art
Method Acting der Regisseurin, einen besseren Zugang, um mit dieser Figur mitzugehen?
Jessica Hausner: Im Gegensatz zu meinen vorigen Filmen ist bei „Lourdes“ diese andere Kraft, die die Hoffnung ist, stärker da.
Und die Arbeit an einem Film ist auch ein Weg etwas über mich herauszufinden oder über das, was mich, aber natürlich auch andere beschäftigt.
Es geht darum anhand dieser Filme eine Erfahrung zu machen, etwas herauszufinden. Während der Recherche habe ich viel mit Gelähmten oder an Multiple
Sklerose Erkrankten gesprochen. Sich mit diesen Menschen zu beschäftigen, mit dieser Extremsituation, etwa in einem Rollstuhl zu sitzen, das hat auch
einen therapeutischen Effekt gehabt. Ich habe immer wieder diese Brücke gefunden, dass diese Situation wirklich umzulegen ist, auf Menschen, die nicht
gelähmt oder krank sind. diese Situation, dass man sich eingeschränkt fühlt in seinem Leben und eben nicht das haben kann, wovon man träumt. Dass sich
bestimmte Dinge anders entwickelt haben, als man sich das früher erhofft hat, oder sich noch immer wünscht. Dass man sich oft fragt, „was tue ich da
eigentlich in diesem Leben“, „wo führt mich das hin?“ Das sind Erfahrungen und Fragen, die Gesunde und Kranke gleichermaßen beschäftigen. Und diese werden
oft als Einschränkung empfunden. Und da herauszugehen, einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen „wie lebe ich dieses Leben weiter“, das ist der beglückende
Aspekt der Geschichte, das ist ja auch dieses Aussteigen aus dem Rollstuhl.
Das Gespräch führte Claus Philipp, Filmkritiker und Geschäftsführer des Stadtkino Filmverleih.