In den deutschsprachigen Regionen Europas wurde der Wald im Laufe der Jahr-hunderte ein bedeutendes Symbol für unsere Identität und ist, besonders heute, stark im öffentlichen Umweltbewusstsein verankert. 47% der österreichischen Staats-fläche sind von Wald bedeckt. Diese Zahl ist besonders dann hilfreich, wenn es darum geht zu verstehen, warum Bäume im kollektiven Unterbewusstsein in Österreich und Deutschland eine funda-mentale Rolle spielen. Dies war der Fall als germanischer Völker noch glaubten, dass eine immer-grüner Esche namens Yggdrasil das gesamte Universum umgab, bis zum Beginn der 1980er. Hier richteten die Medien ihre gesamte Aufmerksamkeit auf das Thema „Waldsterben“ und entfesselten mit Nach-richten über die rapid fortschreitende Ab-nahme des Baumbestands des Landes und dessen Vielfalt Reaktionen, die an kollek-tiven Hysterie grenzten. Es war aber vor allem im 19. Jahrhundert, dass mit den Märchen der Gebrüder Grimm und der Kunstrichtung der Romantik generell der Wald Ursprung der Deutschen ästhetischen Phantasie wurde, und die Systematik seiner ihm zugesprochenen Symbolik an Komplexität zunahm. |
Der Wald in der Österreichischen und Deutschen Literatur – einige Meilensteine 1789
Der Erlkönig, ein Gedicht von Johanns Wolfgang Goethe |
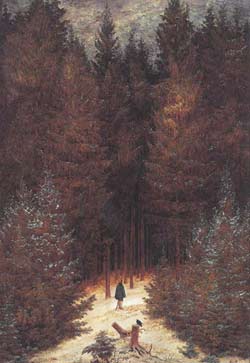 |
|
Im 14. Jahrhundert wurden zahllose Hexenprozesse in ganz Europa von Zivilgerichten unter dem Einfluss und Druck der Katholischen Kirche durchgeführt. Die ersten Menschen wurden im Wald exekutiert indem sie am Scheiterhaufen verbrannt wurden. Nicht nur, dass sich das Österreichische und Deutsche Kaiserreich an einer Welle an Hinrichtungen beteiligte, taten sich die Staaten auch durch die Ermordung von Hexen hervor. Von 1561 bis 1670 wurden 3.229 Menschen wegen Hexerei im Südwesten Deutschlands hingerichtet; dagegen wurden zwischen 1540 und 1685 durch die Spanische Inquisition nur 456 Menschen getötet. Wie in einigen bemerkenswerten Arbeiten von Hans Baldung Grien zusehen ist, wurden Hexen alsbald zu Ikonen des Heidentums – Symbole für alle Möglichkeiten der Auslegung von Sakrilegen; Sündenböcke, die vor allem die Inquisition und deren Führer im Visier hatten. |
 |
||
Abseits
der Tatsache, dass Hexen als Heiden gejagt wurden, standen sie für
Sinneslust, Marginalisierung, Singularität und Ungehorsam, der vernichtet
werden musste. Und wieder taten sich in dieser verbrecherischen Hysterie
die deutsprachigen Regionen Europas besonders hervor. 1670 ächtete
Ludwig XIV. die Hexenjagd; 1692 wurde die letzte diesbezügliche Hinrichtung
in Amerika durchgeführt und 1712 sah man in England den letzten Scheiterhaufen
brennen. Nur in Zentraleuropa verlosch das Feuer erst 1775. Der Stellenwert
der Hexe in der deutschen Volksmythologie wuchs, nicht zuletzt auch wegen
der Gebrüder Grimm, bis sie sich zu einer zwielichtigen Gestalt entwickelte,
wie wir sie heute kennen. Eine Gestalt, die seitdem oft wiederentdeckt
wurde, besonders erwähnenswert scheint Walt Disney’s Schneewittchen
und die Sieben Zwerge. Dies geschah so erfolgreich, dass die Hexe zu einem
Archetyp wurde. Ein Archetyp, der für immer in das kollektive Unterbewusstsein
der Welt eingraviert wurde. |
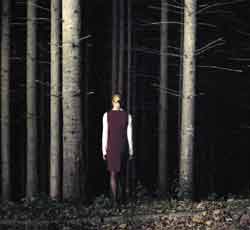
|
||